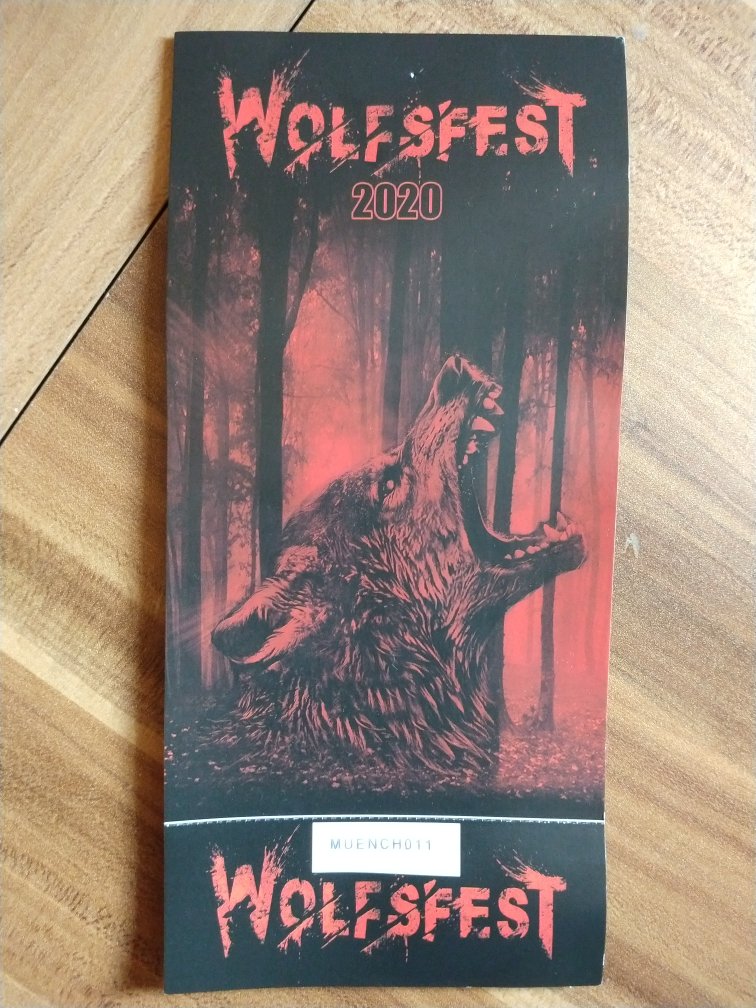Colafleisch ist eine besondere Variante von Schmorbraten mit der Hauptzutat Cola als Garflüssigkeit und Zartmacher. Der Zucker karamellisiert und ergänzt das Gesamtaroma.
Für das Colafleisch wird normalerweise Rindfleisch verwendet (je zarter das Fleisch, desto kürzer ist die Garzeit). Man kann aber auch Schwein oder Geflügel verwenden.
Durch den niedrigen pH-Wert von Cola ist das Getränk recht sauer. Aus diesem Grund wirkt Cola wie eine saure Marinade und die Säure baut einen Teil der Eiweiße im Fleisch ab und damit wird das Fleisch sehr zart.
Zutaten
Als Grundrezept habe ich BBQPit.de und Grillkameraden.de verwendet.

Für ca. 8 – 10 Portionen können folgende Mengen verwendet werden:
- 2 kg Semerrolle vom Rind
- 1,25 Liter Cola
- 400 ml Barbecue-Sauce
- 1 Glas Schattenmorellen (entkernt mit Saft)
- 3 Gemüsezwiebeln
- 2 EL Butterschmalz
- Salz
- Pfeffer
- Rub zum Marinieren
- Optional: 150 ml Whisky
ACHTUNG: Für meinen Dutch Oven mit 4,5 qt war das zu viel von der Menge!
Als Beilagen kann man dann Reis, Nudeln, Kartoffeln oder Spätzle nehmen. Auch kann das fertige Fleisch gut für Burger-Patties verwendet werden.
Vorbereitung und Grillvorgang
Für das Colafleisch ist kaum Vorbereitungszeit notwendig. Es müssen für einen 10 Zoll / 4,5 qt Dutch Oven ca. 16 Briketts vorgeglüht werden (laut Rezept 10 Briketts). Die Hälfte der Kohlen wird dann oben und unten verteilt.
Der Ablauf ist wie folgt:
- Zwiebeln schälen und würfeln
- Butterschmalz in Topf schmelzen (zum Anbraten erhitzen)
- Fleisch rundum (jede Seite ca. 2 Minuten anbraten für Röstaromen)
- Fleisch mit BBQ-Rub würzen und ggf. Salze + Pfeffer
- Zwiebeln im Topf anschwitzen
- Fleisch auf Zwiebeln legen
- Cola verteilen
- BBQ-Sauce hinzufügen
- Kirschen inkl. Saft dazu

Nun wird das Gericht ca. 3 Std. geschmort. Es muss etwas auf Umgebungstemperatur für die Briketts geachtet werden.

Das Fleisch ist fertig, wenn man es mit Gabel einfach zerrupfen kann. Zum Schluss wird das Fleisch mit der Soße vermischt oder die Soße noch etwas eingedickt.

Auf dem Teller
Zu Beginn hat sich schon gezeigt, dass ich entweder zu viel Fleisch, zu viel Zwiebel zu viel Cola oder zu viel Kirschen verwendet (oder das der Top einfach zu klein war). Zum Schluss hatte ich ca. ca. 0,7 Liter Cola anstatt 1,25 Liter im Topf.
In der Kombination hatte ich dann auch zu viel Schattenmorellen / Saft im Topf und das Gericht wurde sehr süß. Durch den fehlenden Whisky hatte ich auch keinen Ausgleich für die Süße der Zutaten zur Hand.
Bei den aktuell stabilen Umgebungstemperaturen ohne Wind haben die Briketts ca. 2,5 Std. gut gehalten. Im Großen und Ganzen ein gutes Gericht, aber für meinen Geschmack zu süß.